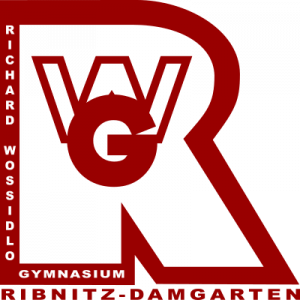Informatik 10: Sprachen und Sprachkonzepte entdecken - Herr Hempel
Abschnittsübersicht
-
Herzlich Willkommen im Kurs Informatik und Medienbildung in der Jahrgangsstufe 10!
Das Fach "Informatik und Medienbildung" in der Jahrgangsstufe 10 baut die Brücke zur Wissenschaft der Informatik. Alle Schülerinnen und Schüler, die in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe keinen Grund- oder Leistungskurs Informatik wählen möchten, erhalten so einen Einblick in Grundkonzepte und Sichtweisen der Informatik, aber auch auf die Grenzen. Sie sollen dadurch in die Lage versetzen werden, mündig in der der digitalen Welt agieren und reagieren zu können. Diejenigen, die Informatik weiterhin belegen wollen, erlernen so die Grundbausteine für die Informatik in der gymnasialen Oberstufe.
Im Kurs "Sprachen und Sprachkonzepte entdecken" untersuchen wir die Darstellung von Information in natürlichen und künstlichen Sprachen und lernen die Grundbausteine von Sprachen kennen. Wir werden erkennen, dass die automatisierte Verarbeitung von Information in Informatiksystemen mit Hilfe von formalen Sprachen erfolgt.
Der Moodle-Kurs begleitet den Unterricht. Sie finden hier alle Tafelbilder, Aufgaben, Dateien, Arbeitsblätter sowie Lösungen. Die Unterlagen werden nach der Behandlung freigegeben.
Stand: 2025-04-06 - Der Kurs wird aktuell gepflegt.
-
-
Daten auf dem Weg - Film 1 und AB 1 Externes Tool
-
Exkurs AB Römische Zahlen Lösungen Datei
-