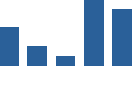Informatik 12 GK/LK: D Algorithmen und Daten - Herr Hempel
Abschnittsübersicht
-
 Herzlich Willkommen im Kurs Informatik 12 D zum Thema Algorithmen und Daten!
Herzlich Willkommen im Kurs Informatik 12 D zum Thema Algorithmen und Daten!Sie werden in diesem Kurs die Grundlagen des imperativen Problemlösens in der Sprache Java aus Klasse 10 wiederholen und festigen. Die Implementierung einfacher Algorithmen und Sortierverfahren bereitet das komplexe Thema Softwareentwicklung vor. Der Leistungskurs beurteilt zudem die Effizienz von Sortieralgorithmen.
Der Moodle-Kurs begleitet den Unterricht. Sie finden hier alle Tafelbilder, Aufgaben, Dateien, Arbeitsblätter sowie Lösungen. Die Unterlagen werden nach der Unterrichtsstunde veröffentlicht.
Stand 2025-11-23: Dieser Kurs ist aktuell geschlossen und wird nicht gepflegt.
Lehrbücher:
Eingesetzt werden die Lehrbücher Informatik 1 (2014) und Informatik 2 (2014) aus dem Verlag Schöningh.
-
-
Das Tutorial führt uns durch algorithmische Strukturen und Grundlagen der Programmierung. Beachten Sie, dass sich die Turtle-Befehle in den Beispielen von unseren hier unterscheiden. Sie können also nicht die Quelltexte kopieren.
-
Lösungen Einfaches Zeichnen Datei
-
Lösungen Einfache Schleifen Datei
-
Lösungen Verschachtelte Schleifen Datei
-
Lösungen Verzweigungen Datei
-
Komplexe Übungen Teil 1 Lösungen Datei
-
Lösungen Komplexes Datei
-
-
01 Notizen Lösung Datei
-
02 Notenlisten Lösung Datei
-
-
Öffnen Sie die beiden Datensammlungen in verschiedenen Tabellenkalkulationssystemen (OnlyOffice, LibreOffice Calc, MS Excel, Google Tabellen).
- Ermitteln Sie die Anzahl der vorhandenen Datensätze.
- Sortieren Sie die darin enthaltenen Daten jeweils nach einem Kriterium und schätzen Sie ab, welches Programm die Daten an schnellsten sortiert.
- Untersuchen Sie die Dauer des Sortierens, falls die Daten bereits sortiert sind, umgekehrt sortiert sind sowie eine beliebige Reihenfolge haben.
- Welche Probleme sind Ihnen beim Öffnen und Sortieren der Daten aufgefallen?
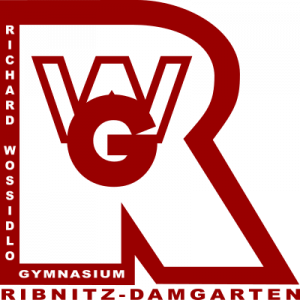
 Joe (links oben) und Ina, zwei soeben geschlüpfte Schildkröten
Joe (links oben) und Ina, zwei soeben geschlüpfte Schildkröten